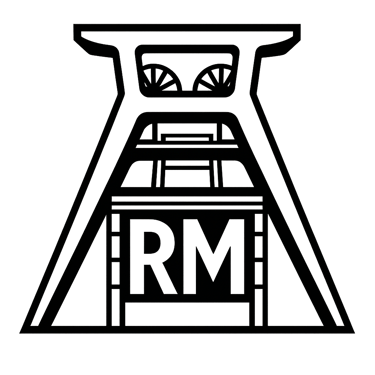Köpenicker Blutwoche 1933 – Fotografien aus dem ehemaligen Gefängnis
Am 3. September 2022 bot sich die Gelegenheit, im ehemaligen Gefängnis des Amtsgerichts Köpenick zu fotografieren. Das Gebäudeensemble – bestehend aus dem Amtsgericht und dem daran angebauten Gefängnistrakt – wurde in den Jahren 1899 bis 1901 nach einem Entwurf des preußischen Baubeamten Paul Thoemer errichtet und steht seit 1977 unter Denkmalschutz. Die fotografische Arbeit zielte nicht auf ästhetisch „schöne“ Motive, sondern auf die Dokumentation eines historischen Erinnerungsortes. Im Juni 1933 ereignete sich in diesem Gefängnis ein Massaker – später als „Köpenicker Blutwoche“ bezeichnet –, als Hunderte politische Gegner, Jüdinnen und Juden sowie Gewerkschaftsmitglieder von der SA inhaftiert, gefoltert und mindestens 23 von ihnen getötet wurden.
BERLIN-BLOG
In seinem Buch „Am Rand um ganz Berlin“ (2020) beschreibt Paul Scration im Kapitel „Dunkelheit am Rand der Stadt“ (S. 40 ff.) seine Gedanken beim Blick auf das Gefängnisgebäude:
„Nach dem Ermächtigungsgesetz im März desselben Jahres wurde die Etablierung einer Diktatur in Deutschland durch die gewaltsame Unterdrückung der – realen und imaginären – Gegner des neuen Regimes vorangetrieben. Dabei war die Woche vom 21. bis zum 26. Juni 1933 eine der blutigsten dieser Zeit, als das Köpenicker Gericht zum Schauplatz von Verhören, Folter, Inhaftierungen und sogar Morden an Sozialdemokraten, Juden, Gewerkschaftlern und jedem anderen wurde, der in den Verdacht geriet, eine Bedrohung für die neue Ordnung zu sein. Einige der Opfer der Köpenicker Blutwoche starben im Gefängnis des Gerichtsgebäudes an den Folgen ihrer „Befragung“. Andere fand man tot in den Wäldern um die Stadt, die Leichen wieder anderer hatte man in den Fluss geworfen, von dem sie in den darauffolgenden Tagen wieder an Land gespült wurden.
Dabei versuchte man nicht einmal, die Terrortaten geheim zu halten, im Gegenteil: Man machte sie beinahe öffentlich, um die Menschen einzuschüchtern und ihnen klarzumachen, was sie erwartete, sollten sie es wagen, sich dem nationalsozialistischen Regime zu widersetzen. Insgesamt wurden in der Köpenicker Blutwoche über 500 Menschen verhaftet, mindestens 24 von ihnen starben. So lange waren die Nazis da noch gar nicht an der Macht, doch zeigten die Ereignisse dieser Juniwoche im Jahr 1933 mehr als deutlich, dass NSDAP und staatliche sowie zivile Institutionen bereits an einem Strang zogen. Hinten im Hof, in den Räumlichkeiten des ehemaligen Gefängnisses, in denen die Verhöre und Folterungen stattgefunden haben, erzählt heute eine Ausstellung von den Geschehnissen in der Köpenicker Blutwoche. Die Ausstellung macht auch deutlich, dass solcherlei Gräueltaten nicht nur dazu dienten, politische Gegner und als Bedrohung empfundene Individuen auszuschalten, sondern auch – in den Worten der Ausstellungskuratoren – als 'Experiment der Gewaltetablierung im Nationalsozialismus.' "