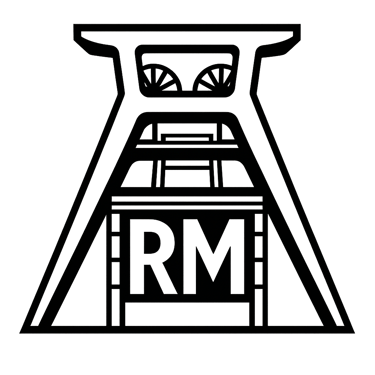Aspekte der Erinnerung: DDR-Fotografie im Spiegel der Einheit
Der Sonntags-Blog im Oktober 2025 erscheint am Ende eines langen Wochenendes. In diesem Jahr fiel der „Tag der Deutschen Einheit“ am 3. Oktober auf einen Freitag – für viele vermutlich vor allem ein günstiger Termin im Kalender, der einen zusätzlichen arbeitsfreien Tag bedeutete. Andere nutzen den Tag, um an die sogenannte Wiedervereinigung zu denken: das Ende der DDR und ihren „Beitritt“ zur Bundesrepublik. Für mich war es vor allem eine Gelegenheit, in Bildbänden mit Fotografien aus der DDR aus meiner Fotobuchsammlung zu blättern und Texte zu lesen, die diese Bilder in neue Zusammenhänge stellen.
SONNTAGS-BLOG
Reinhard Mokros
10/5/2025
Fotografie in und über die DDR
Das Thema DDR-Fotografie ist vielschichtig und lässt sich nicht auf eine einfache Definition reduzieren. Im engeren Sinn meint man damit die Arbeiten jener Fotografinnen und Fotografen, die in der DDR lebten und dort bis zur Wende tätig waren – Bilder also, die im alltäglichen wie im offiziellen Kontext vor 1990 entstanden sind. Doch die Geschichte ist komplizierter. Auch Fotografinnen und Fotografen aus Westdeutschland haben die DDR in ihren Bildern festgehalten, sei es während kurzer Besuche oder während längerer Aufenthalte. Ihre Perspektiven unterscheiden sich – und erweitern den Blick auf das Land um eine Dimension von Nähe und Distanz zugleich.
Offizielle Bilder und verborgene Bestände
Auch die Frage nach der Veröffentlichung spielt eine Rolle. Manche Fotografien fanden schon zu DDR-Zeiten den Weg in Zeitschriften, Bücher oder Ausstellungen. Andere blieben im Verborgenen und wurden erst nach 1990 bekannt. Hier zeigt sich ein Spannungsfeld zwischen dem offiziellen Bild, das eine Gesellschaft von sich selbst zeichnen wollte, und den Bildern, die erst später als Gegenentwurf oder Korrektiv sichtbar wurden.
Auftragsfotografie und künstlerische Projekte
Darüber hinaus lässt sich eine Unterscheidung zwischen Auftragsarbeiten – etwa Modefotografien oder Reportagen – und freien Projekten treffen, bei denen die Motivwahl ausschließlich von den Fotografinnen und Fotografen getroffen wurde. Diese Arbeiten werden häufig als „künstlerische Fotografie“ bezeichnet. Gerade solche Fotos standen jedoch in einem Spannungsverhältnis zu den ideologischen Vorgaben der politischen Führung, weshalb ihre Präsentation in Ausstellungen in der DDR teilweise von staatlicher Seite untersagt wurde.
Nach 1989 wurden vor allem sozialdokumentarische Arbeiten in Ausstellungen und Bildbänden gezeigt. Die Fotos rücken Aspekte des Alltags in den Vordergrund, die im offiziellen Diskurs weitgehend unsichtbar blieben, und eröffnen damit Erzählungen jenseits der staatlich propagierten Narrative.
Amateurfotografie und Wiederentdeckungen
Nach 1990 wurden schließlich auch viele Fotografien von ambitionierten Amateuren sichtbar. Manche waren schon zuvor in kleinen Ausstellungen zu sehen, andere blieben lange unbeachtet und wurden erst später wiederentdeckt. Auch sie tragen dazu bei, das Bild der DDR zu vervielfältigen – ein Bild, das sich aus vielen Schichten zusammensetzt und bis heute nicht abgeschlossen ist.
Ikonische Momente 1989
Eine besondere Kategorie bilden die Fotografien, die im Herbst 1989 entstanden. Sie dokumentieren die Demonstrationen und Proteste, die schließlich in den Mauerfall am 9. November mündeten – Ereignisse, die später unter dem Begriff der „friedlichen Revolution“ zusammengefasst wurden. Diese Bilder haben längst ikonischen Status erlangt: Sie stehen für Aufbruch, für den Mut der Bürgerinnen und Bürger und für das Ende eines Staates, der vierzig Jahre lang existiert hatte.
Staatsinszenierung und kritische Dokumentation
Ebenso prägend sind die Fotografien, die im Umfeld des 40. Jubiläums der DDR am 7. Oktober 1989 aufgenommen wurden. Entstanden im Spannungsfeld zwischen offizieller Staatsinszenierung und kritischer Dokumentation, spiegeln sie die Widersprüche jener Tage: Auftragsarbeiten im Dienst der Repräsentation standen neben Projekten engagierter Fotografinnen und Fotografen aus Ost und West, die den Riss zwischen Inszenierung und Realität sichtbar machten.
Fotografie im Übergang
Auch nachdem die DDR als Staat nicht mehr existierte, setzte sich die DDR-Fotografie fort. Entstanden sind dabei Bilder, die die Phase des Übergangs dokumentieren oder bewusst einen Vorher-nachher-Vergleich inszenieren. Manche dieser Arbeiten sind von einer klar soziologischen Perspektive geprägt: Sie verbinden Fotografien mit textlichen Beschreibungen oder mit Aussagen von Bewohnerinnen und Bewohnern und schaffen so ein vielschichtiges Bild des gesellschaftlichen Umbruchs. Doch bleibt die Frage offen, ob diese Fotografien in erster Linie Dokumente des Wandels sind – oder bereits Interpretationen einer Transformation, deren Deutung bis heute nicht abgeschlossen ist.
Gerade am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, stellt sich daher die Frage neu: Welche dieser Schichten prägen eigentlich unser kollektives Gedächtnis an die DDR – die kanonisierten, die offiziellen oder die zufällig überlieferten? Diese Fragen möchte ich in einem Essay zur DDR-Fotografie beantworten, den ich auf dieser Homepage veröffentlichen werde.