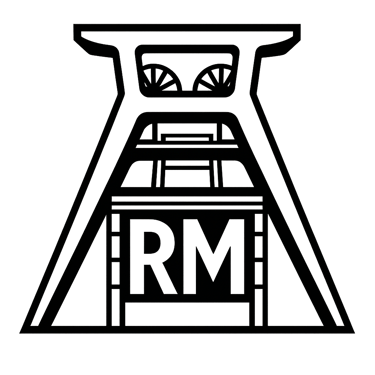Die Kunst des Sehens: Kausale und finale Fotografie
Fotografie ist nicht nur das Festhalten von Motiven, sondern ein bewusster Akt des Sehens. Martin Kriegelstein beschreibt in seinem Artikel „Die Kunst des Sehens“ (brennpunkt, H. 1/2018, S. 88) zwei unterschiedliche Herangehensweisen, die den fotografischen Prozess prägen: die kausale Fotografie und die finale Fotografie. Diese Begriffe eröffnen eine neue Perspektive darauf, wie Bilder entstehen – spontan oder planvoll, intuitiv oder konzeptionell.
SONNTAGS-BLOG
Finale Fotografie und konzeptionelle Auftragsarbeiten
„Die finale Fotografie ist immer zielgerichtet, das bedeutet vorrangig auf das Ergebnis fokussiert“ (Kriegelstein 2018:88). Ihr Schwerpunkt ist die sogenannte Auftragsfotografie, bei der das Bildergebnis weitgehend durch den Kunden vorgegeben wird (ebd.). Das Foto muss einen bestimmten Zweck erfüllen, wie zum Beispiel die positive visuelle Darstellung eines Produktes in der Werbefotografie oder die Dokumentation eines Schadens für eine Versicherung (ebd.).
Nach Martin Kriegelstein (2018: 88) besitzt der Fotograf in der finalen Fotografie „kaum eine Möglichkeit, viel von seiner Individualität in das Bild einzubringen“. Diese Einschätzung trifft jedoch nur bedingt zu. Insbesondere in der Werbe- und Modefotografie werden Aufträge gezielt an bestimmte Fotografinnen und Fotografen vergeben, gerade weil deren individuelle Bildsprache und kreative Handschrift gefragt sind, um den visuellen Ausdruck der Aufnahmen unverwechselbar zu gestalten.
Ein prägnantes Beispiel hierfür sind die Werbekampagnen von United Colors of Benetton, die Oliviero Toscani mit einer stark wiedererkennbaren, oft provokativen Bildsprache geprägt hat. Ebenso sind die Modefotografien von Peter Lindbergh durch einen dokumentarisch anmutenden Stil, den bewussten Verzicht auf übermäßige Retusche und eine besondere Nähe zu den porträtierten Personen gekennzeichnet – Merkmale, die Lindberghs Arbeiten eine unverwechselbare, individuelle Handschrift verleihen.
Auch im Bildjournalismus lässt sich Individualität deutlich nachweisen. Die fotografischen Arbeiten von Barbara Klemm für die Frankfurter Allgemeine Zeitung zeigen, wie stark persönliche Sichtweisen und gestalterische Entscheidungen den Charakter eines Bildes bestimmen. Klemms Porträts und Reportagen, oft in Schwarz-Weiß gehalten, zeichnen sich durch eine präzise Komposition, eine subtile Lichtdramaturgie und eine besondere Sensibilität für historische und gesellschaftliche Momente aus. Damit prägt sie nicht nur die visuelle Identität der Zeitung, sondern zeigt exemplarisch, wie in bildjournalistischen Kontexten individuelle Ausdrucksformen und journalistische Objektivität miteinander verbunden werden können.
Das zentrale Merkmal finaler Fotografie liegt in der konzeptionellen Planung und bewussten Steuerung des fotografischen Prozesses. Sie ist nicht primär vom spontanen Moment geprägt, sondern von einer zuvor entwickelten gestalterischen Idee, die Aufnahme, Auswahl und Nachbearbeitung leitet. Finale Fotografie beschränkt sich keineswegs ausschließlich auf kommerzielle oder auftragsgebundene Arbeiten. Martin Kriegelstein (2005: 13) empfiehlt auch Amateurfotografinnen und -fotografen, kontinuierlich an einem klar umrissenen fotografischen Thema zu arbeiten und es systematisch nach einem durchdachten Konzept weiterzuentwickeln.
Ein solches Vorgehen eröffnet die Möglichkeit, fotografische Projekte mit inhaltlicher Tiefe und kohärenter Bildsprache zu gestalten. Die wiederholte Auseinandersetzung mit einem Thema schärft nicht nur den Blick für visuelle Details, sondern führt auch zu einer zunehmenden Verdichtung von Ausdruck und Aussagekraft der Bilder. Damit rückt die finale Fotografie näher an künstlerische und dokumentarische Arbeitsweisen heran, bei denen langfristige Planung und thematische Stringenz eine zentrale Rolle spielen.
In meiner eigenen Praxis wird diese Herangehensweise etwa bei Projekten sichtbar, die eine systematische Erkundung bestimmter Themen oder Orte verfolgen. So plane ich für mein Fotoprojekt Wanderungen durch die Mark Brandenburgdie Route, die Standorte und die Tageszeiten für bestimmte Aufnahmen im Voraus. Ziel ist es, die historischen und landschaftlichen Spuren der Region in einer Bildserie zu verdichten, die den Geist von Fontanes Beschreibungen aufgreift. Die Fotografien entstehen hier nicht zufällig, sondern sind Teil eines konzeptionellen Prozesses, der von Beginn an auf eine spätere Veröffentlichung – etwa in Buchform – ausgerichtet ist.
Kausale Fotografie und der fotografische Flaneur
In seinem Aufsatz hebt Martin Kriegelstein (2018: 88) hervor, dass er die kausale Fotografie bevorzugt und diese mit der „künstlerischen Fotografie“ gleichsetzt. Die „Kunst des Sehens“ besteht für ihn darin, „hier seine eigene individuelle Sichtweise in das Bild einzubringen – ein Teil der eigenen Seele zu spiegeln“ (ebd.).
Ob ein Foto tatsächlich „ein Teil der eigenen Seele“ spiegeln kann, wie es Kriegelstein (2018: 88) beschreibt, ist aus theoretischer Perspektive problematisch. Fotografische Bilder sind mediale Konstruktionen, die stets durch technische Apparaturen, gestalterische Entscheidungen und visuelle Konventionen vermittelt werden. Selbst bei stark subjektiv geprägten Aufnahmen bleibt die Fotografie an äußere Bedingungen wie Licht, Raum und Materialität gebunden, sodass nur indirekt Rückschlüsse auf innere Befindlichkeiten gezogen werden können. Statt das „innere Wesen“ der Fotografierenden unmittelbar abzubilden, lässt sich vielmehr die „Haltung“ einer Person erkennen – verstanden als individuelle Perspektive, gestalterische Intention und bewusste Positionierung gegenüber dem fotografierten Gegenstand.
An anderer Stelle beschreibt Manfred Kriegelstein (2007: 6) die „Seele des Bildes“ folgendermaßen: „Für mich hat ein Bild eine Seele, wenn es mich berührt, wenn es über den visuellen Eindruck hinaus eine Tür in mir öffnet, die neue Sichten oder Empfindungen ermöglicht“ (ebd.). Diese Auffassung unterscheidet sich grundlegend von der Vorstellung, dass ein Foto die Seele des Fotografen spiegele. Während letztere Annahme auf den inneren Ausdruck der fotografierenden Person zielt, versteht Kriegelstein die „Seele des Bildes“ vielmehr als Wirkungspotenzial einer Fotografie, das sich erst in der Rezeption entfaltet und beim Betrachtenden neue Wahrnehmungs- und Empfindungsräume eröffnet.
Diese Unterscheidung zwischen der Spiegelung der Seele des Fotografen und der „Seele des Bildes“ verweist auf unterschiedliche Dimensionen fotografischer Ausdruckskraft. Während erstere eine subjektive Innensicht betont, richtet sich letztere auf die Wirkung des Bildes beim Betrachtenden. Damit wird ein zentrales Charakteristikum der kausalen Fotografie berührt: Sie entsteht weniger aus konzeptioneller Planung als vielmehr aus einem offenen, wahrnehmenden Prozess, bei dem die individuelle Haltung des Fotografen situativ in die Aufnahme einfließt und so die emotionale Resonanz des Bildes ermöglicht.
Diese fotografische Haltung lässt sich mit der Figur des Flaneurs verbinden, wie sie in der Literatur und Kulturtheorie – etwa bei Walter Benjamin – beschrieben wird. Der Flaneur bewegt sich ohne festes Ziel durch die Stadt, offen für das Unerwartete, aufmerksam für Details und Atmosphären. Die Kamera ist dabei Werkzeug und Begleiter, nicht Instrument zur Umsetzung eines festen Plans. In meiner Stadtfotografie zeigt sich dies in Aufnahmen, die beim ziellosen Streifen durch urbane Räume entstehen: Ein plötzliches Schattenspiel auf der Fassade eines alten Industriegebäudes, ein von Regen glänzender Gehweg, der das Licht einer Straßenlaterne spiegelt, oder eine flüchtige Begegnung zweier Passanten an einer Straßenecke. Solche Bilder entstehen ohne vorherige Absicht und bewahren das Flüchtige des Augenblicks – so wie es der Flaneur erlebt.
Fazit
Kriegelsteins Begriffe kausale und finale Fotografie helfen, die Spannbreite fotografischer Praxis zu verstehen:
Die kausale Fotografie des Flaneurs reagiert intuitiv auf den Moment und bewahrt den spontanen Charakter des urbanen Lebens – wie in Straßenaufnahmen, die im Vorübergehen entstehen und vom Zufall bestimmt sind.
Die finale Fotografie ist ein planvoller, gestalterischer Akt, der auf ein konkretes Endprodukt hinarbeitet – sichtbar in Projekten, die von der ersten Skizze bis zur finalen Bildauswahl strukturiert vorbereitet werden.
Beide Ansätze sind wertvoll und ergänzen sich: Spontane Street Photography kann denselben fotografischen Blick schulen, der später in einer konzeptionellen Auftragsarbeit bewusst eingesetzt wird. Fotografie bleibt damit immer ein Prozess des Sehens – mal zufällig entdeckend, mal zielgerichtet gestaltend.
Literaturnachweise
Kriegelstein, Manfred (2005): Die „Bierdeckel-Axiome“ der Amateur-Photographie. In: brennpunkt, Heft 3, Seite 13.
Kriegelstein, Manfred (2007): Wie empfinden wir Bilder? In: Sammellinse, Heft 2, Seite 6.
Kriegelstein, Manfred (2018): Die Kunst des Sehens. In: brennpunkt, Heft 1, Seite 88.
Mein Beitragsinhalt