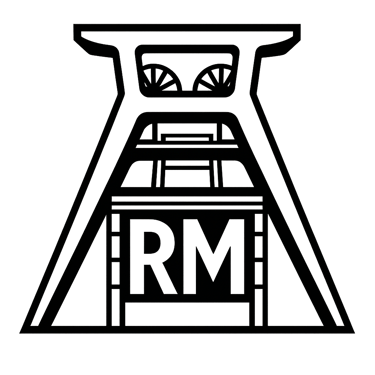Unverschämte Schönheit
In der Doppelnummer 7–8/2025 der Zeitschrift PHOTONEWS fiel auf Seite 17 eine großformatige Anzeige ins Auge. Sie zeigt Ben Hoppers Fotografie Maya Felix [1] aus der Serie Natural Beauty [2] und wirbt für die Ausstellung „Unverschämte Schönheit. Achselhaare als Tabu?“. Kuratiert von Klaus Honnef, vereint die Ausstellungen Fotografien aus der Sammlung von Michael Horbach. Mit der Anzeige sucht die Michael Horbach Stiftung nach neuen Ausstellungsorten, um die Sammlung, die bislang in Köln und Jena gezeigt wurde, weiter einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dieser Hinweis bietet einen geeigneten Anlass, den Sammler Michael Horbach, seine fotografische Sammlung, die Ausstellung sowie die Rolle privater Sammlerinnen und Sammler in einem Blog-Beitrag näher zu beleuchten.
SONNTAGS-BLOG
Reinhard Mokros
8/24/2025
Unverschämte Schönheit
Michael Horbach – Sammler, Mäzen und Stifter
Michael Horbach wurde 1950 in Aachen geboren. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre an der RWTH Aachen gründete er 1983 die HORBACH Wirtschaftsberatung, die er im Jahr 2000 verkaufte, um sich fortan sozialen und kulturellen Projekten zu widmen. Er gründete die Michael Horbach Stiftung, die insbesondere Projekte fördert, die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen soll und verbindet Horbachs Engagement für soziale Gerechtigkeit mit kultureller Förderung. Das vorrangige Ziel aller Stiftungsaktivitäten ist die „Hilfe zur Selbstentwicklung“. „Eine gerechte Welt ist möglich“ ist der Leitgedanke, unter der sich alle von der Stiftung geförderten Projekte zusammenfassen lassen. [3]
Seit 2011 betreibt die Stiftung die Kunsträume in der Kölner Südstadt. In fünf Ausstellungsräumen und vier Kabinetten wird dort auf über 600qm² Kunst der Gegenwart aus der facettenreichen Sammlung des Gründers präsentiert. Neben der dauerhaft inszenierten Sammlung werden in regelmäßigen Abständen Ausstellungen aus den Bereichen zeitgenössischer Fotografie und Malerei gezeigt. [3] Die Räume fungieren als lebendiger Ort der Begegnung, an dem zeitgenössische Fotografie, gesellschaftliches Engagement und kulturelle Teilhabe zusammengeführt werden.
Die Stiftung vergibt alle zwei Jahre einen Fotopreis in Höhe von 10.000 Euro sowie Stipendien für fotografische Nachwuchstalente. Mit den Stipendien soll insbesondere jungen, noch unbekannten Künstlerinnen aus anderen Kulturkreisen Unterstützung gewährt werden. Gefördert werden Frauen, die sich erst am Beginn ihrer künstlerischen Laufbahn befinden und daher in besonderem Maße auf Förderung angewiesen sind. Das Programm umfasst einen mehrmonatigen Aufenthalt in der Atelierwohnung der Kunsträume; die währenddessen entstehenden Arbeiten werden im Anschluss in einer Ausstellung präsentiert [3].
In einem Interview mit Damian Zimmermann für die Zeitschrift PROFIFOTO (H. 12/2020) anlässlich seines 70. Geburtstags berichtete Michael Horbach, dass ihn insbesondere die Freundschaft mit der kolumbianischen Künstlerin Lucana erstmals in größerem Umfang zum Sammeln angeregt habe. Er erklärte, dass er vorzugsweise junge, noch unbekannte Künstlerinnen und Künstler berücksichtige, da dies spannender, kostengünstiger und aus sozialer Perspektive sinnvoller sei [4].
Die Sammlung von Michael Horbach umfasst heute mehr als 1.000 Fotografien. Der Sammler legt besonderen Wert auf zeitgenössische Fotografie aus Südamerika und Kuba, und verfolgt das Ziel, die kreative und sozialkritische Perspektive dieser Künstlerinnen und Künstler zu vermitteln sowie den Betrachterinnen und Betrachtern Einblicke in deren Lebenswelten zu ermöglichen. Ein weiterer Schwerpunkt der Sammlung liegt auf Aktfotografie, wobei Werke von Helmut Newton, Jock Sturges, Olaf Martens, Herlinde Koelbl und Lee Friedländer vertreten sind. Thomas Karsten ist mit größeren Konvoluten seiner erotischen Arbeiten in der Sammlung präsent [3].
Im Interview mit Damian Zimmermann erläuterte der Sammler, dass er früher vorwiegend in Galerien kaufte und bei Auktionen ersteigerte, inzwischen jedoch nahezu ausschließlich Arbeiten von den Künstlern erwerbe, die er aktuell ausstelle. Dabei bevorzuge er es, mehrere Arbeiten für insgesamt 5.000 Euro zu erwerben, statt eine einzelne Arbeit zu diesem Preis [4]. Die von ihm ausgestellten Arbeiten verkauft Michael Horbach zu einem günstigen Preis von 300 Euro auch an andere Sammlerinnen und Sammler, wobei der Erlös vollständig den Künstlerinnen und Künstlern zugutekommt [3].
„Unverschämte Schönheit“ – Ausstellungskonzept und Fragestellung
Die Ausstellung Unverschämte Schönheit war vom 10. Juli bis 19. August 2022 in den Kunsträumen der Michael Horbach Stiftung zu sehen. Gezeigt wurden 160 Fotografien von 60 Fotografinnen und Fotografen, darunter Herlinde Koelbl, Birgit Kleber, Lee Friedlander, Ralph Gibson, Thomas Karsten, Helmut Newton und Cole Weston. Alle ausgestellten Fotografien stammen aus Horbachs Sammlung. Gemeinsam ist ihnen, dass bei den abgebildeten Frauen die Achselhaare und bei den Aktaufnahmen auch die Schamhaare sichtbar sind.
Kuratiert wurde die Schau von Klaus Honnef, der zudem einen 177-seitigen Begleitband in hervorragender Druckqualität herausgab (Honnef 2022). Der Band enthält sowohl ein Gespräch zwischen Michael Horbach und Klaus Honnef als auch ein Essay von Honnef mit dem Titel Die unverschämte Seite der Schönheit. Thesen zu Michael Horbachs fotografischer Sammlung zum Thema Achselhaare.
Im Gespräch mit Klaus Honnef erläuterte Michael Horbach, er sei 1996 durch einen Artikel in der Frauenzeitschrift Elle mit dem Titel Venus im Pelz von Beatrice Bohn erstmals auf das Thema aufmerksam geworden. Bohn habe darin ein Plädoyer für Achselbehaarung formuliert und betont, dass deren Entfernung für sie einen Verlust weiblicher Erotik darstelle. Sie habe zudem die Auffassung vertreten, dass nur Männer, die Angst vor der ungezähmten weiblichen Kraft hätten, von einer vollständig enthaarten Frau schwärmten (Honnef 2022: 710).
Auch wenn Michael Horbach einräumte, eine erotische Beziehung zu Achselhaaren zu haben, da er das „Glatte, Zurechtgestutzte und Barbie-Puppenhafte“ ablehne, betonte er im Gespräch mit Damian Zimmermann, dass sein Sammeln nicht erotisch motiviert sei, sondern vor allem gesellschaftskritische Aspekte verfolge. Sein Interesse gelte dem Zwang, den Moden auf Frauen ausüben, sowie jenen Frauen, die sich diesen Zwängen entziehen. So berichtete er von Beobachtungen während eines Sommerurlaubs auf der Insel Rügen, wo sich am Umgang mit der Achselbehaarung deutlich ablesen ließ, ob die Frauen aus Ost- oder Westdeutschland stammten. Damit verwies Horbach auf die subtilen sozialen Codes, die sich in Praktiken von Mode und Körperpflege jener Zeit manifestierten.
Darauf angesprochen, dass sich in seiner Sammlung auch Fotografien namhafter Künstler wie Helmut Newton, Henri Cartier-Bresson, Edward Weston und Manuel Álvarez Bravo finden, erklärte Michael Horbach, er habe deren Werke bewusst aufgenommen, um zu verdeutlichen, dass Achselhaare ein anerkanntes Motiv der künstlerischen Fotografie ohne obszönen Beigeschmack darstellen (Honnef 2022: 10 f.). Wichtig ist Horbach zudem, dass zahlreiche Fotografinnen Frauen mit Achselbehaarung porträtiert haben. Für ihn war es aufschlussreich zu beobachten, wie sie dieses Thema aufgriffen, da ein ausschließlich männlicher Blick leicht in den Verdacht der Obszönität geraten wäre. Darüber hinaus, so Horbach, verfügten Fotografinnen seiner Ansicht nach häufig über eine subtilere Wahrnehmung erotischer Zwischentöne (ebd.: 11).
Die Ausstellung thematisiert die gesellschaftliche Konstruktion von Körperlichkeit und Tabus. Indem die Fotografien jene Aspekte des Körpers sichtbar machen, die im öffentlichen Diskurs häufig ausgeblendet oder stigmatisiert werden, verweisen sie auf Spannungen zwischen privaten Körperpraktiken und sozialen Normen. Zugleich lässt sich die Präsentation aber auch ausschließlich aus ästhetischer Perspektive betrachten: Es handelt sich um eine eindrucksvolle Zusammenstellung von Porträts, Halbakten und fragmentarischen Körperdarstellungen von hoher fotografischer Qualität. Der Fokus auf Achsel- und Schamhaare unterstreicht dabei die Natürlichkeit der abgebildeten Frauen. Die Bilder entfalten eine subtile Erotik, die weniger aus Pose als vielmehr aus der ungezwungenen und selbstbewussten Präsenz der Frauen vor der Kamera erwächst. Viele Fotografien vermitteln den Eindruck von Intimität. Die Betrachtenden erscheinen dabei nicht als Voyeure, sondern eher als „stille Teilhaber“.
Private Fotosammlerinnen und -sammler als Akteure des Kulturbetriebs
Im Begleitband zur Präsentation der Sammlung des Filmregisseurs und Produzenten Thomas Koerfer im Kunsthaus Zürich wirft Christoph Becker die Fragen auf, was eine Sammlung im Kern ausmacht und wer als Sammler zu gelten hat. Er betont, dass dem Sammeln stets das Suchen vorausgehe: Das Gefundene werde zu einer größeren Menge vereint, in Besitz genommen und aufbewahrt. Mit dem Sammeln sei zugleich etymologisch das „Sondern“ verbunden, also die bewusste Abgrenzung der ausgewählten Objekte von anderen. Becker versteht dies als ein willentliches Vorgehen intelligenter Individuen, das sich als ursprünglichste Form des Ordnens beschreiben lasse. In diesem Sinne bilde die Ordnung – nach der Wahl der Objekte – ein wesentliches Merkmal jeder Sammlung (Becker 2015: 10).
Nach Christoph Becker entstehen die ersten Sammlungen, die sich ausschließlich auf Werke der bildenden Kunst konzentrieren, Mitte des 18. Jahrhunderts im Zuge eines Prozesses der Spezialisierung. Sie seien, so Becker, als Produkt der Aufklärung zu verstehen (Becker 2015: 10). Diese Charakterisierung verweist auf eine grundlegende Veränderung der Sammlungspraxis: Während vormoderne Kunst- und Wunderkammern heterogene Objekte aus Natur, Technik und Kunst vereinten, wird im Zeitalter der Aufklärung die klare Trennung der Wissensbereiche angestrebt. Sammlungen bildender Kunst entstehen damit nicht nur aus ästhetischem Interesse, sondern spiegeln zugleich das auf Rationalität, Systematisierung und Klassifikation ausgerichtete Denken der Epoche wider. In ihnen manifestiert sich der Versuch, Kunstwerke nach nachvollziehbaren Kriterien zu ordnen und sie als eigenständigen Bereich kultureller Bildung und bürgerlicher Selbstvergewisserung zu etablieren.
Private Sammlungen fotografischer Werke lassen sich historisch bereits ab den 1840er Jahren nachweisen, kurz nachdem die Fotografie als Medium etabliert war. Zu Beginn handelte es sich vor allem um frühe daguerreotypische Porträts, Ansichten und Naturstudien, die wohlhabende Einzelpersonen aus Interesse an Technik, Kunst oder Dokumentation erwarben.
Im späten 19. Jahrhundert, etwa ab den 1870er und 1880er Jahren, verbreitete sich das Sammeln von Fotografien stärker, insbesondere in bürgerlichen Kreisen. Sammler erwarben Fotografien sowohl aus ästhetischem als auch aus dokumentarischem Interesse – etwa Porträts, Landschaften, Architektur- oder Industrieaufnahmen. Die frühen privaten Sammlungen bildeten damit die Grundlage für die späteren institutionellen Fotografiesammlungen in Museen, als Fotografie zunehmend als eigenständige Kunstform und Kulturgut anerkannt wurde. Die ersten fotografischen Sammlungen in deutschen Museen entstanden im späten 19. Jahrhundert, als die Fotografie zunehmend als eigenständiges künstlerisches Medium anerkannt wurde.
Der Handel mit Fotografien etablierte sich in Deutschland erst viel später. 1973 gründeten Wilhelm Schürmann und Rudolf Kicken die Galerie Lichttropfen im Obergeschoss einer Buchhandlung in Aachen. Zeitgleich existierten in Deutschland die Galerie von Ann und Jürgen Wilde sowie in Österreich die Galerie Die Brücke, die ebenfalls Fotografien vermarkteten. Letztere gilt als erste Fotogalerie Europas (vgl. Schürmann 2019).
Die Bedeutung privater Sammlungen für die Fotografie
Dass Michael Horbach über eine Anzeige in PHOTONEWS nach einem Ausstellungsort für „Unverschämte Schönheit“ sucht, verdeutlicht die zentrale Rolle privater Sammlerinnen und Sammler für den Kulturbetrieb. Ohne ihr Engagement wären viele fotografische Positionen kaum sichtbar geworden. Bedeutende Beispiele sind die Sammlung F. C. Gundlachin Hamburg, die maßgeblich zur Anerkennung der Modefotografie beigetragen hat, die legendäre Sammlung von L. Fritz Gruber, die das Fundament der Photokina-Bilderschauen bildete, oder das Ehepaar Fricke, das mit seiner Sammlung zentrale Werke der Nachkriegsfotografie bewahrte. Auch Ann und Jürgen Wilde eröffneten durch ihre Galerie und Sammlung neue Zugänge zur Geschichte der Fotografie. Michael Horbach reiht sich mit seiner Initiative in diese Tradition ein.
Private Sammlungen sind nicht nur Orte der Bewahrung, sondern Impulsgeber für neue Perspektiven. Sie ergänzen und bereichern die Arbeit öffentlicher Institutionen und tragen entscheidend dazu bei, dass Fotografie als Kunstform im kulturellen Diskurs präsent bleibt.
Interquellen
[1] https://www.therealbenhopper.com/Projects/Natural-Beauty/51 (23.8.2025).
[2] https://therealbenhopper.com/Projects/Natural-Beauty (23.8.2025).
[3] http://www.michael-horbach-stiftung.de (23.8.2025).
[4] https://www.damianzimmermann.de/blog/interview-mit-dem-sammler-michael-horbach/ (23.8.2025).
Literaturnachweise
Becker, Christoph: Der Sammler im Museum. In: Kunsthaus Zürich (Hrsg.): Sinnliche Ungewissheit. Eine private Sammlung. Heidelberg/Berlin: Kehrer Verlag, 2015, S. 8-12.
Honnef, Klaus (Hrsg.): Unverschämte Schönheit. Sammlung Michael Horbach [Kunsträume Michael Horbach Stiftung Köln, 10. Juli bis 19. August 2022]. Achim: BerlinDruck, 2022.
Wilhelm Schürmann im Gespräch mit Philipp Fernandes do Brito, 23. Februar 2019. In: sediment. Materialien und Forschungen zur Geschichte des Kunstmarkts, Nr. 30/2019, S. 227-240.