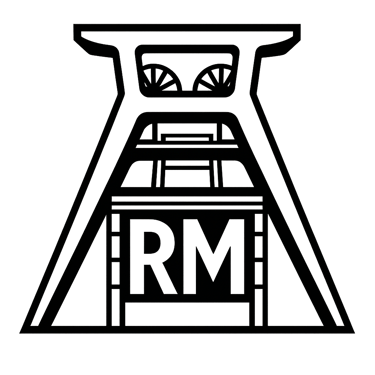Dirk Reinartz: totenstill
Vom 15. Mai bis 16. September 2024 zeigte das LVR-Landesmuseum Bonn die Ausstellung Dirk Reinartz – Fotografieren, was ist. Anlässlich meines 70. Geburtstages im Juni 2024 lud ich Freunde zu einem gemeinsamen Ausstellungsbesuch mit Führung ein. Unter den Gästen war auch Manfred Kistermann aus Aachen, der seit seiner Jugend mit Dirk Reinartz befreundet war und bis zu dessen frühem Tod engen Kontakt zu ihm hielt. In Bonn wurden unter anderem Arbeiten aus dem Werkzyklus totenstill präsentiert. Ein Foto aus dieser Serie, das ich zuvor in der Wohnung von Manfred Kistermann gesehen hatte, weckte mein Interesse am Werk von Dirk Reinartz. Am 15. September 2024 veröffentlichte ich einen Essay zu dem Buch totenstill.
Reinhard Mokros
Das Buch „totenstill“ ist ein ungewöhnliches Buch, denn es enthält 230 schwarzweiß Fotos von ehemaligen Konzentrationslagern der Nationalsozialisten, die keinen Text illustrieren, sondern – jeweils auf einer Seite abgedruckt – für sich allein stehen. Bei solchen Abbildungen fällt es schwer, von einem „schönen“ Buch zu sprechen und doch wurde „totenstill“ beim Wettbewerb „Die schönsten deutschen Bücher“ der „Stiftung Buchkunst“ mit dem 1. Preis und im November 1994 mit dem „Kodak Fotobuch Preis“ ausgezeichnet.
Der Historiker Christian Graf von Krockow verfasste für das Buch einen Text zur Geschichte und Struktur der nationalsozialistischen Konzentrationslager mit dem Titel „Ordnung und Absonderung“ (S. 17-45) sowie ein „Vorwort“ (S. 7) und einen „Epilog“ (S. 7). „Krockows Text wurde so im Buch platziert, dass ihm eine Serie mit acht Aufnahmen aus Dachau, dem ersten Konzentrationslager der Nationalsozialisten, vorausgeht. Die Bilder aus Dachau bilden somit einen Prolog und exponieren motivisch-programmatisch, was in den weiteren Kapiteln zu insgesamt 24 Konzentrations- und Vernichtungslagern folgt. (…) Die Reihenfolge der abgebildeten Lager ergibt sich aus den Daten ihrer Errichtung. So folgen den Bildern aus Dachau und dem Emsland Aufnahmen von Konzentrationslagern wie Buchenwald, die erst gegen Ende der 1930er Jahre entstanden. An die KZs auf deutschem Territorium schließen sich die mit Kriegsbeginn in ganz Europa errichteten Lager an. Nach Aufnahmen aus Vernichtungslagern wie Treblinka und Auschwitz bilden Fotografien aus Bergen-Belsen den Abschluss: Hier endeten zahlreiche Todesmärsche, zu denen die SS tausende Häftlinge auf der Flucht vor den Alliierten zwang“ (Valk 2024: 242).
Die Ausstellungsmacher haben sich dazu entschieden, die Bilder aus „totenstill“ im LVR Museum Bonn als eigenständige Präsentation in einem Raum zu zeigen. Das war eine gute und dem Thema angemessene Entscheidung. In dem lang gestreckten Raum sind an den weißen Wänden rechts und links die (kleinformatigen) schwarzweiß Fotos gehängt. Schwarze Balken markieren die einzelnen Orte, deren Namen oberhalb der Fotos in schwarzer Schrift genannt werden. Beim Betreten des Raumes hat man den Eindruck, als würden man an einem (Lager-)Zaun entlang blicken. Nichts lenkt vom Betrachten der Fotos ab. Dokumente zum Projekt „totenstill“ sind im benachbarten Ausstellungsraum zu sehen, denn Vitrinen würden die Präsentation der Fotos stören. Die Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, Tafeln in die Hand zu nehmen, auf denen Faksimiledrucke von Rezensionen in Zeitschriften und Zeitungen aufgeklebt sind. Die Texte (zumeist kritisch) regen zur Diskussion an.
Die Aussage von Sebastian Lux (2024: 20) zur gesamten Ausstellung, gilt besonders für diesen Teil: „Wenn Reinartz mit seiner Fotografie zu Wahrnehmung und eigenständigem Denken anregen wollte, so schafft die Retrospektive seines fotografischen Lebenswerks einen neuen kritischen Raum, in dem Fragestellungen, die er in seiner Fotografie reflektiert hat, neu zur Diskussion gestellt werden.“ Weiterlesen... (PDF)