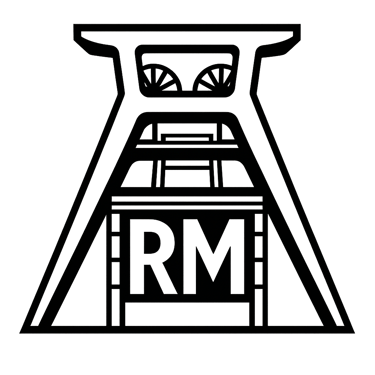Schöpfungshöhe
Ausgehend von Manfred Kriegelsteins Überlegungen zum Begriff "Schöpfungshöhe" reflektiert dieser Beitrag über Eigenart und Wiederholung in der zeitgenössischen Fotografie. Im Fokus stehen der Einfluss von Trends, Wettbewerben und Workshops auf die Bildgestaltung – am Beispiel der Street Photography und im Dialog mit Manfred Kriegelsteins Kritik an der visuell normierten Amateurfotografie. Ein Plädoyer für das eigensinnige Sehen jenseits etablierter Formeln.
SONNTAGS-BLOG
Ein Wiederlesen mit aktueller Relevanz
An diesem Sonntag habe ich nach längerer Zeit den Aufsatz „Die Schöpfungshöhe“ von Manfred Kriegelstein (2014) erneut gelesen. Der Begriff Schöpfungshöhe verweist im juristischen Sinne auf den Grad schöpferischer Eigenleistung, der notwendig ist, damit ein Bild als Werk im Sinne des Urheberrechts gilt. Doch weit über diesen engen Rahmen hinaus ist er auch ein produktiver Denkbegriff für fotografische Praxis: Schöpfungshöhe bedeutet in diesem weiteren Sinn jene visuelle Haltung, durch die ein Bild zur Aussage wird – subjektiv geprägt, reflexiv im Umgang mit Form und Inhalt, widerständig gegenüber bloßer Wiederholung.
Schöpfungshöhe als Maßstab für Eigenständigkeit
Kriegelstein (2014: 88) betont, dass der urheberrechtliche Schutz eines Bildes mehr verlangt als technische Ausführung oder ästhetische Gefälligkeit: Er setzt eine persönliche geistige Prägung voraus. Schöpfungshöhe wird so zu einem Kriterium für Eigenart – und damit zu einem Maßstab, der auch für die fotografische Selbstreflexion fruchtbar ist. Denn die Frage, was ein Bild eigentlich auszeichnet, betrifft nicht nur Rechte, sondern Haltungen. Er schreibt:
"Fotografie ist 'Subjektivierung der Umwelt' oder anders ausgedrückt, eine kreative lichtbildnerische Interpretation dessen, was ich sehe. Vereinfacht gesagt: Je größer die Schöpfungshöhe eines Bildes, desto größer sein künstlerischer Wert!" (Kriegelstein 2014: 88)
"Aber eben genau an dieser Schöpfungshöhe" - so der Autor - "mangelt es den meisten Bildern in der Amateurszene" (ebd.).
Als Grund dafür nennt Kriegelstein (2014: 88) das "Kopieren von Vorbildern", gefördert durch fotografische Workshops und Lehrgänge sowie durch die Prämierung bestimmter Fotos bei Fotowettbewerben.
Wettbewerbe und das Prinzip der Wiederholung
Dass fotografische Eigenart im Wettbewerbssystem gefährdet ist, hat Manfred Kriegelstein bereits 2008 in seinem Beitrag „Auf einen Pfau folgen immer Pfauen“ analysiert. Seine Metapher vom „Pfauenbild“, das nach Auszeichnung massenhaft imitiert wird, verweist auf einen problematischen Mechanismus: Bildmuster, die prämiert werden, erzeugen Nachahmung. Was nicht ins ästhetische Raster passt, bleibt unsichtbar. So reproduzieren Wettbewerbe oft nicht Vielfalt, sondern Konformität – auch wenn sie das Gegenteil suggerieren.
Street Photography als Beispiel normierter Bildsprache
Die gegenwärtige Street Photography zeigt exemplarisch, wie ein fotografisches Genre, das ursprünglich für Spontaneität, Beobachtungsschärfe und individuelles Sehen stand, zunehmend zur stilistisch erstarrten Formel wird. Was heute massenhaft als „gelungene“ Street Photography präsentiert wird, folgt oft einem wiedererkennbaren Muster: Linien, Farbfelder, Schlagschatten, grafische Strukturen, dazu ein oder zwei zufällig ins Bild tretende Passant*innen, die das kompositorische Gefüge scheinbar „vollenden“. Es handelt sich um eine Ästhetik, die auf Wirkung setzt – visuell unmittelbar zugänglich, formal eingängig, aber in hohem Maße wiederholbar.
Ein Schlüsselfigur dieser Entwicklung ist der Hamburger Fotograf Siegfried Hansen, dessen Arbeiten durch eine präzise grafische Struktur, formale Reduktion und bewusste Abstraktion geprägt sind. Was als individueller Zugang zur urbanen Umgebung begann – als Versuch, die Stadt als Bildraum jenseits dokumentarischer Absicht zu erschließen –, hat sich längst zu einer weithin rezipierten Stilvorlage entwickelt. Hansen selbst trägt durch die regelmäßige Vermittlung seines Ansatzes in Workshops dazu bei, dass sich seine Bildsprache in der Amateurfotografie verbreitet hat – nicht als Anregung zur Reflexion, sondern als Rezept zur Nachahmung.
Der Erfolg dieses Ansatzes – Ausstellungen, Buchpublikationen, internationale Anerkennung – hat zur Folge, dass sich eine wachsende Zahl von Fotografierenden an der Hansen’schen Formel orientiert. In Wettbewerben, in sozialen Medien, in Portfolio-Sichtungen dominieren Bilder, die dieser Ästhetik verpflichtet sind: clean, strukturiert, graphisch raffiniert, aber zunehmend austauschbar. Was in Hansens Frühwerk noch als Ausdruck visueller Eigenart wahrnehmbar war, erscheint in vielen dieser Reproduktionen als formalisiertes Erfolgsmodell. Der subjektive Blick wird ersetzt durch eine antrainierte Bildgrammatik.
Im Sinne der Schöpfungshöhe ergibt sich daraus ein strukturelles Problem: Die bloße Anwendung eines bekannten Konzepts – sei es auch formal überzeugend ausgeführt – reicht nicht aus, um ein Bild zu einem Werk im eigentlichen Sinne zu machen. Die fotografische Entscheidung verliert an Tiefe, wenn sie nicht aus der individuellen Wahrnehmung, sondern aus der Orientierung an stilistischen Vorbildern erwächst. Der Prozess der Imitation erzeugt dabei nicht nur ästhetische Redundanz, sondern unterminiert auch das zentrale Kriterium schöpferischer Eigenleistung: die persönliche geistige Prägung, von der Kriegelstein spricht.
Workshops und die Ästhetik des Gelingens
Auch Workshops und Fotoreisen verstärken die Tendenz zur Normierung, wenn sie vor allem auf Resultate ausgerichtet sind. Teilnehmerinnen und Teilnehmer fotografieren, was innerhalb der Gruppe Anerkennung findet oder stilistisch mit der Kursleitung kompatibel ist. Die Entwicklung eines eigenen Blicks wird so nicht gefördert, sondern überlagert. Was entsteht, ist häufig „Standardware“ – ein Begriff, den Kriegelstein als Synonym für visuelle Mittelmäßigkeit gebraucht.
Einprägsam ist mir ein Workshop auf der Insel Rügen in Erinnerung geblieben. Beim Fotografieren in einem Buchenwald erläuterte der Fototrainer die sogenannte „Wischtechnik“ – eine Aufnahmetechnik, bei der die Kamera während einer langen Belichtungszeit bewusst bewegt wird. Die Fotografinnen und Fotografen setzten dies unmittelbar um, und es entstanden jene abstrahierten Bilder, wie sie damals in nahezu jeder Fotozeitschrift präsent waren.
Schöpfungshöhe als fotografische Haltung
Gegen diese Dynamiken lässt sich der Begriff Schöpfungshöhe als kritisches Korrektiv denken: nicht im engen juristischen Sinne, sondern als Ausdruck gestalterischer Haltung. Schöpfungshöhe beginnt dort, wo ein Bild nicht bloß reproduziert, sondern befragt – das Motiv, das Medium, die eigene Wahrnehmung. Sie zeigt sich in der Abweichung, nicht in der Bestätigung. In der Entscheidung, einen anderen Weg zu gehen, auch wenn dieser nicht prämiert wird.
Der Verlust des Anderen und die Notwendigkeit der Differenz
Besorgniserregend ist die von Manfred Kriegelstein beschriebene Tendenz, dass nicht-konforme Arbeiten kaum noch sichtbar werden – und damit auch keine Nachfolge mehr finden. In einem System, das auf Wiedererkennbarkeit beruht, fehlt die Voraussetzung für Weiterentwicklung. Schöpfungshöhe bedeutet in diesem Kontext nicht Innovation um jeden Preis, sondern das Bestehen auf Differenz – gegen visuelle Routine, gegen das Kalkül des Erfolgs.
Fazit: Schöpfungshöhe im dokumentarischen Arbeiten – eine Standortbestimmung
Nach der erneuten Lektüre des Artikels über den Begriff der Schöpfungshöhe habe ich mich gefragt, welche Schlüsse ich daraus für meine eigene fotografische Praxis ziehen kann. Manfred Kriegelstein (2014: 88) bezieht den Begriff explizit auf die „künstlerische Fotografie“, die seiner Auffassung nach „nur weiter kommen [kann], wenn sie aus neuen kreativen Impulsen wächst.“ Diese Aussage zielt auf Innovation, auf Brüche mit Konventionen, auf das Überschreiten etablierter Bildsprachen.
Meine Fotografie hingegen versteht sich nicht als künstlerische Position, sondern als dokumentarische Praxis. Mein Ziel ist es nicht, durch ästhetische Transformation Bedeutung zu erzeugen, sondern durch aufmerksame Beobachtung Wirklichkeit sichtbar zu machen. Insofern unterscheidet sich mein fotografischer Ansatz grundlegend von jenen Formen, auf die sich die Diskussion um Schöpfungshöhe im engeren, juristischen oder kunsttheoretischen Sinn häufig bezieht.
Dennoch bleibt die Frage nach dem schöpferischen Moment auch für die dokumentarische Fotografie relevant. Denn auch hier stellt sich die Frage nach der eigenen Haltung, nach der Auswahl des Motivs, nach dem Blickwinkel, nach der Bildsprache. Dokumentarisch zu arbeiten bedeutet nicht, sich der Form zu enthalten – im Gegenteil: Es bedeutet, mit den Mitteln der Fotografie eine Aussage über das Vorgefundene zu treffen. Der dokumentarische Blick ist nie neutral. Er ist gebunden an Entscheidungen – und in dieser Entscheidung liegt, im erweiterten Sinne, auch ein Moment schöpferischer Eigenart.
Was ich aus der Auseinandersetzung mit dem Begriff der Schöpfungshöhe mitnehme, ist deshalb kein Maßstab im Sinne einer künstlerischen Originalität, sondern eine Frage an meine fotografische Praxis: Inwiefern gelingt es mir, durch wiederkehrende Aufmerksamkeit, durch langfristige Beschäftigung mit Themen, Orten oder Situationen eine visuelle Haltung auszubilden, die mehr ist als dokumentarisches Festhalten? Wo tritt in meinen Bildern eine Form von Sehen zutage, die über das bloß Abbildhafte hinausgeht – nicht, weil sie verfremdet, sondern weil sie präzisiert?
Im dokumentarischen Arbeiten ist Schöpfungshöhe weniger ein Anspruch auf Werkstatus, sondern eine Haltung der bewussten Wahrnehmung. Sie zeigt sich nicht in der formalen Neuerung, sondern in der Konsequenz des Blicks. In diesem Sinn verstehe ich meine Fotografie als einen Prozess, in dem sich Wahrnehmung verdichtet – nicht spektakulär, nicht innovativ im künstlerischen Sinn, aber aufmerksam, wiederholend, strukturierend. Vielleicht liegt gerade darin jene Form von gestalterischer Eigenart, die dem Begriff der Schöpfungshöhe in einer erweiterten Lesart auch für dokumentarisches Arbeiten Bedeutung verleiht.
Quellen:
Kriegelstein, Manfred (2014): Die Schöpfungshöhe. In: brennpunkt, 3/2014, S. 88.
Kriegelstein, Martin (2008): Auf einen Pfau folgen immer Pfauen. In: Sammellinse, 2/2008, S. 8.