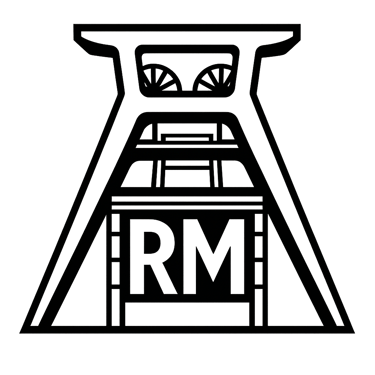Wege der Sichtbarkeit: Fotografie zwischen Sammlung und Ausstellung
In der letzten Ausgabe des Sonntags-Blogs berichtete ich über die Initiativen von Michael Horbach, Teile seiner Fotosammlung auch jenseits seiner eigenen Ausstellungsräume in Köln einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. An dieses Thema der Sammlungspräsentation knüpfe ich in der heutigen Ausgabe an – aus Anlass meines Besuchs der Ausstellung "On View. Begegnungen mit dem Fotografischen" in der Münchener Pinakothek der Moderne.
SONNTAGS-BLOG
Reinhard Mokros
9/7/2025
Es gibt viele Arten, Fotografien zu sammeln – und ebenso viele Arten, mit den Sammlungen umzugehen. Manche Sammlerinnen und Sammler bewahren ihre Bilder als stille Schätze, die höchstens im privaten Kreis gezeigt werden. Einen anderen Typus bilden Unternehmen wie Banken oder Versicherungen, die Fotografien in erster Linie als Kapitalanlage erwerben. Diese Bestände verschwinden oft in Tresoren und bleiben der Öffentlichkeit entzogen. Andere Sammlerinnen und Sammler präsentieren die Werke in professionell kuratierten Ausstellungen. Nur wenige von ihnen verfügen allerdings über eigene Ausstellungsräume; die Mehrheit ist auf Galerien, Museen oder spezialisierte Ausstellungshäuser wie C/O Berlin oder die Deichtorhallen in Hamburg angewiesen. Dorthin gelangen die Sammlungen entweder temporär für eine Ausstellung, als Dauerleihgabe oder in Form einer Schenkung.
Einen besonderen Weg beschritt der Sammler Artur Walther, der in seinem Heimatort Neu-Ulm eigens einen Campus für seine umfangreiche Fotosammlung errichten ließ. Walther, 1948 in Burlafingen bei Neu-Ulm geboren, studierte in den 1970er-Jahren an der Harvard Business School und machte Karriere an der Wall Street. 1994 zog er sich aus dem Berufsleben zurück, um sich ganz der Fotografie zu widmen – zunächst als Fotograf, bald aber vor allem als Sammler. [1] Heute bildet zeitgenössische Fotografie aus China und Afrika den Schwerpunkt der Fotosammlung.
Nach dem Tod seiner Mutter entschied Walther, das elterliche Haus in einen Ausstellungsort umzuwandeln. Daraus entstand The Walther Collection, die 2010 eröffnet wurde. Der Campus liegt in einem ruhigen Wohngebiet von Neu-Ulm und umfasst vier Gebäude, verbunden durch Gehwege. Neben Büro, Bibliothek und Gästewohnung bilden die White Box, das Green House und das Black House die zentralen Ausstellungsräume. Der kubische Neubau der White Box ergänzt zwei umgebaute Wohnhäuser aus den 1950er- und 1970er-Jahren. Um die Maßstäblichkeit der Umgebung zu wahren, wurde die 500 m² große Hauptgalerie ins Untergeschoss verlegt; kleinere Galerien und ein Leseraum ergänzen das Ensemble. [2]
Nach fünfzehn Jahren hat sich Artur Walther entschlossen, seine Sammlung mit rund 6.500 Fotografien dem Metropolitan Museum of Art in New York zu schenken. Damit setzt er konsequent fort, was er von Beginn an als Aufgabe des Sammlers verstand: die Kunst der Vermittlung. Was einst im Elternhaus in Neu-Ulm begann, findet nun seine Fortführung in einem der bedeutendsten Museen der Welt – in jener Stadt, in der Walther seit über vier Jahrzehnten lebt und die seine Sicht auf Fotografie entscheidend geprägt hat. Über die künftige Nutzung der Räume in Neu-Ulm wurde bislang noch nicht entschieden (A.G. 2025:16).
Sammlungen als Museumsbestände
Die Walther Collection ist nicht die erste Fotosammlung, die in den Bestand eines Kunstmuseums übergeht. Zahlreiche Museen verdanken ihre fotografischen Bestände Stiftungen oder dem Ankauf ganzer Privatsammlungen. Ein aktuelles Beispiel bietet die Pinakothek der Moderne in München: Dort ist noch bis zum 12. Oktober 2025 die Ausstellung On View. Begegnungen mit dem Fotografischen zu sehen, die Werke aus dem Hausbestand zeigt, der überwiegend aus ehemaligen Privatsammlungen stammt.
Mit der Gründung der Pinakothek der Moderne im Jahr 2002 fand die Fotografie erstmals Eingang in die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Erst viele Jahre später wird der auf mehr als 10.000 Werke angewachsene Bestand nun in einer umfassenden Überblicksschau präsentiert. Maßgeblichen Anteil hat die Sammlung Ann und Jürgen Wilde mit ihrem Schwerpunkt auf der Fotografie der Moderne sowie den Künstlerarchiven von Karl Blossfeldt und Albert Renger-Patzsch (Salzberger 2025: 8). Einen weiteren Grundstock bilden die Unternehmenssammlungen der Siemens AG und der Allianz SE mit Fokus auf die 1970er Jahre (Salzberger 2025: 8).
Die Überführung privater Sammlungen in Museen bietet für Sammler mehrere Vorteile. Die Werke werden professionell konserviert und langfristig unter optimalen klimatischen und sicherheitstechnischen Bedingungen erhalten. Gleichzeitig gewinnen sie durch die museale Präsentation öffentliche Sichtbarkeit, die über private Ausstellungen hinausgeht, und leisten einen Beitrag zur kunsthistorischen Forschung. Wissenschaftliche Aufbereitung und Dokumentation, etwa in Ausstellungskatalogen und Online-Datenbanken, steigern zudem den kulturhistorischen und ökonomischen Wert der Fotografien. In der Pinakothek der Moderne profitieren die Werke nicht nur von kuratorischer Expertise, sondern auch von der Einbettung in einen größeren historischen und thematischen Kontext, der neue Perspektiven auf die fotografische Moderne eröffnet (Salzberger 2025: 8).
Damit zeigt sich, dass Privatsammlungen im Museum nicht nur bewahrt, sondern zugleich für die Öffentlichkeit fruchtbar gemacht werden. Sie tragen entscheidend dazu bei, Fotografie als eigenständige Kunstform im kulturellen Gedächtnis zu verankern.
Die Fotosammlung des Kunstpalasts: Eine „gemischte Tüte“ statt klarer Konzeption
Seit einigen Jahren scheint es zum Renommee vieler Kunstmuseen zu gehören, über eine eigene fotografische Sammlung zu verfügen. Ein Beispiel bietet der Kunstpalast Düsseldorf, wo erst 2019 der Sammlungsbereich Fotografie eingerichtet und eine Kuratorin berufen wurde. Zuvor lag die Zuständigkeit für Fotografie bei den Abteilungen Graphik und Moderne Kunst; Ankäufe erfolgten nur vereinzelt, ergänzt durch Schenkungen, etwa von Bernd und Hilla Becher (Conze 2020: 8). Den Hauptteil des heutigen Bestandes von rund 3.500 Fotografien bildet der im Dezember 2018 erworbene Bestand der Galerie Kicken Berlin mit etwa 3.000 Arbeiten. [3]
Mit dem Ankauf der Sammlung Kicken investierte Düsseldorf 2018 über acht Millionen Euro – mehr als je zuvor in eine Kunstsammlung – und verschaffte sich damit auf einen Schlag eine umfangreiche Fotosammlung. Der Bestand umfasst mehrere Tausend Abzüge und deckt rund 150 Jahre Fotogeschichte ab, wenn auch mit Lücken (Fricke 2020). Während die Stadt den Erwerb als kulturpolitisches Signal feierte, stieß die Höhe der Summe in der Kunstwelt auf Erstaunen. Kritiker wie Manfred Heiting verwiesen darauf, dass ein Großteil der Arbeiten aus späteren Abzügen, Mappenwerken und anonymen Fotografien besteht und somit eher dem Warenlager einer Galerie als einer systematisch aufgebauten Museumssammlung ähnelt. Tatsächlich handelt es sich bei der „Sammlung Kicken“ nicht um eine gezielt aufgebaute Sammlung, sondern um den in über vier Jahrzehnten durch ständige Zu- und Abflüsse entstandenen Warenbestand einer Galerie (Fricke 2020).
Auf seiner Homepage hebt der Kunstpalast die Vielfalt der neuen Fotosammlung hervor: Große Namen wie Henry Fox Talbot, Man Ray oder Bernd und Hilla Becher treten neben weniger bekannten Positionen, das Einzelbild steht neben der Serie. Die Sammlung deckt ein breites zeitliches Spektrum ab, vereint zahlreiche Autorinnen und Autoren und eröffnet zugleich Einblicke in unterschiedliche Verwendungszusammenhänge der Fotografie. So werden Ikonen der Kunstgeschichte durch Röntgenaufnahmen, Pressebilder, Werbefotografien und private Schnappschüsse ergänzt und in neue Kontexte gestellt.
Der Bestand wurde vom 19. Februar bis 17. Mai 2020 in der Ausstellung Sichtweisen präsentiert, begleitet von einem aufwendig gestalteten Katalog (Conze 2020). Ausstellung und Publikation machten jedoch deutlich, dass die Sammlung weniger einer gezielt strukturierten Konzeption folgt, sondern eher einer „gemischten Tüte“ gleicht – eine Mischung, die exemplarisch zeigt, wie wertvoll dagegen eine systematisch aufgebaute Fotosammlung für die museale Vermittlung und kunsthistorische Einordnung ist.
Angesichts der eingesetzten Finanzmittel stellt sich die Frage, ob das Geld nicht sinnvoller in die Gründung eines spezialisierten Fotomuseums investiert worden wäre. In den Niederlanden lässt sich beobachten, wie derartige Einrichtungen erfolgreich arbeiten.
Internetquellen:
[1] https://www.parnass.at/news/artur-walther (2.9.2025).
[2] https://www.baunetzwissen.de/beton/objekte/kultur/walther-collection-in-burlafingen-1286185 (2.9.2025).
[3] https://www.kunstpalast.de/de/programm/sammlung/die-sammlung-fotografie/ (2.9.2025)
Literaturnachweise:
A. G. [Anna Gripp] (2025): Met erhält The Walther Collection. Schenkung von 6.500 Fotografien, Alben und Werken. In: PHOTONEWS, H. 7-8, S. 16.
Conze, Linda: Fotografie: Eine neue Sammlung für Düsseldorf. In: Diess. (Hrsg.): Sichtweisen. Die neue Sammlung Fotografie [Kunstpalast Düsseldorf, 19. Februar bis 17. Mai 2020]. Berlin: DISTANZ Verlag, S. 8-15.
Fricke, Christian (2020): Fotokollektion für acht Millionen Euro – War die Sammlung zu teuer? In: Handelsblatt online, 07.05.2020 – 16.55 Uhr, https://www.handelsblatt.com/arts_und_style/kunstmarkt/ankauf-fuer-duesseldorf-fotokollektion-fuer-acht-millionen-euro-war-die-sammlung-zu-teuer/25807128.html (2.9.2025).
Salzberger, Roswitha (2025): On View. Begegnungen mit dem Fotografischen in der Pinakothek München. In: PHOTONEWS, H. 9, S. 8.