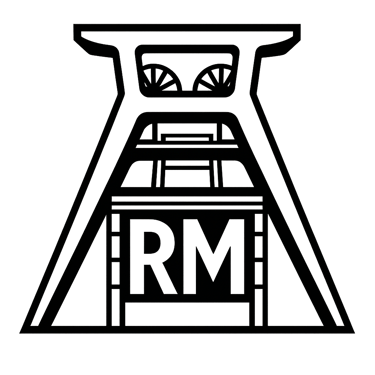KI und Fotografie: Zwischen Wahrheit, Imagination und visueller Wachsamkeit
Die Künstlerin Lori Nix baut ihre apokalyptischen Welten noch von Hand – Diorama für Diorama. Doch könnte sie ihre Visionen heute nicht auch mit Hilfe künstlicher Intelligenz erschaffen? Die Frage führt mitten hinein in die aktuelle Debatte um den Wahrheitsanspruch der Fotografie, um Authentizität, Täuschung und eine neue Kultur des Sehens.
SONNTAGS-BLOG
Reinhard Mokros
11/2/2025
1. Analoge Konstruktionen des Imaginären
Vor zehn Jahren, vom 10. Mai bis zum 9. August 2015, zeigte das Museum Schloss Moyland in Bedburg-Hau die Ausstellung Lori Nix: The Power of Nature. Die amerikanische Künstlerin Lori Nix (*1969) wurde dort erstmals in einem europäischen Museum präsentiert. Ihre Fotografien inszenieren Szenarien des Verfalls und der Wiederaneignung urbaner Räume durch die Natur. Ausgangspunkt ist stets ein Diorama, das sie gemeinsam mit ihrer Partnerin Kathleen Gerber in monatelanger Handarbeit im Atelier baut, um es anschließend zu fotografieren. Die Miniaturen zeigen eine Welt nach dem Menschen – Bibliotheken, Museen oder U-Bahnstationen im Zustand des Verfalls, überwuchert von Pflanzen, bevölkert von Insekten, erfüllt von einer paradoxen Schönheit des Scheiterns.
Christiane Fricke beschreibt diese Bildwelten als „faszinierende Vision einer verfallenden Welt ohne Menschen“ (Fricke 2015). In der Serie The City entwirft Nix urbane Räume, in denen Katastrophe und Neubeginn ununterscheidbar ineinander übergehen. Die Natur erscheint nicht als zerstörerische, sondern als schöpferische Kraft. Diese Ambivalenz verweist auf eine grundlegende Frage der Gegenwartsfotografie: Wie lässt sich die Beziehung von Mensch, Technik und Natur im Bild denken?
Beim Blättern im Katalog der Ausstellung stellte sich mir die Frage, ob die Künstlerin ihre komplexen Miniaturwelten heute nicht mit Hilfe einer KI-Software wesentlich schneller erschaffen könnte.
Das mag zwar so sein, aber das Werk der Künstlerin steht exemplarisch für eine „analoge Konstruktion des Imaginären“ (Fricke 2015). Es betont die Materialität und Körperlichkeit des fotografischen Prozesses, den bewussten Umgang mit Licht, Raum und Zeit. Gerade in der Gegenüberstellung zu KI-generierten Bildern, die ohne physische Weltbegegnung entstehen, wird sichtbar, dass ihre Fiktionen auf Erfahrung beruhen – auf der sinnlichen Auseinandersetzung mit Wirklichkeit. Für mich war die Wiederbegegnung mit den Fotos der Künstlerin ein Anstoß, um mich mit dem Thema Künstliche Intelligenz in der Fotografie zu befassen.
2. Die Fotografie und ihr Wahrheitsanspruch
Die Auseinandersetzung mit Künstlicher Intelligenz führt unweigerlich zurück zu jenem alten Mythos, der die Fotografie seit ihrer Erfindung begleitet: der Vorstellung, sie sei ein getreues Abbild der Wirklichkeit. Wie Dario Varéb (2025: 43) hervorhebt, beruht diese Überzeugung auf einem kulturell tief verankerten Bedürfnis nach visueller Beglaubigung – nach Bildern, die als Beweis dienen, dass etwas tatsächlich existiert hat. Seit dem 19. Jahrhundert wurde der Fotografie daher ein besonderer Wahrheitswert zugeschrieben. Sie galt als technisches Auge, das unabhängig von subjektiver Wahrnehmung die Welt so festhält, „wie sie ist“.
Doch diese Vorstellung war von Beginn an trügerisch. Schon in der Frühzeit der Fotografie wurde die vermeintliche Objektivität des Mediums unterlaufen. Studioaufnahmen des 19. Jahrhunderts zeigen aufwendig drapierte Szenen, die soziale und familiäre Rollen idealisierten. Besonders deutlich tritt der Konstruktionscharakter in der sogenannten Post-mortem-Fotografie hervor – einem Genre, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weit verbreitet war. Verstorbene wurden in häuslicher Umgebung fotografiert, sorgfältig zurechtgemacht, oft aufrecht sitzend oder liegend, um einen friedlichen Schlaf zu suggerieren. Solche Bilder dienten den Hinterbliebenen als letzte Erinnerung, zugleich aber auch als Beweis einer fortbestehenden familiären Kontinuität.
In der Konfrontation mit KI-generierten Bildern kehrt dieses Paradox in neuer Form zurück. Auch KI-Bilder bedienen sich der visuellen Grammatik der Fotografie – Perspektive, Schärfe, Lichtführung –, beruhen jedoch nicht auf einem physikalischen Ereignis, nicht auf dem Einfall von Licht auf eine lichtempfindliche Fläche, sondern auf algorithmischer Berechnung. Sie sind, wie Varéb betont, keine Abbilder, sondern Simulationen, „Visualisierungen von Datensätzen“. Damit unterläuft die KI die ontologische Grundlage des fotografischen Bildes: die Spur, die auf ein reales Geschehen verweist.
3. Wenn Bilder ihre Beweiskraft verlieren
Dr. Jürgen Scriba, Physiker und Leiter der Arbeitsgruppe „Technischer Fortschritt“ im Deutschen Fotorat, sieht in der Künstlichen Intelligenz die bislang tiefgreifendste Herausforderung für das Verständnis fotografischer Wahrhaftigkeit. Seine Diagnose ist radikal: „Wenn klar ist, dass jedes Bild gefälscht sein kann, dann ist das genauso, als wäre jedes Bild gefälscht“ (Scriba 2025: 11). In diesem Satz verdichtet sich der Befund einer kulturellen Verunsicherung: Mit dem Verlust technischer Eindeutigkeit verliert die Fotografie ihre gesellschaftliche Rolle als Garant visueller Wahrheit. Das fotografische Bild, einst Beweismittel im juristischen, journalistischen und historischen Sinn, wird zum potenziell manipulierbaren Datensatz – und damit zum Träger von Ambiguität.
Scriba verweist auf aktuelle politische Kampagnen, in denen KI-generierte Bilder gezielt eingesetzt werden, um Emotionen zu verstärken und Meinungen zu formen. Die Glaubwürdigkeit solcher Bilder beruht nicht mehr auf ihrer indexikalischen Verbindung zur Wirklichkeit, sondern auf ihrer affektiven Wirkung. Entscheidend ist nicht länger, ob ein Bild „wahr“ ist, sondern ob es sich „richtig anfühlt“ (ebd.). Diese Verschiebung markiert einen grundlegenden Wandel in der visuellen Kultur: Authentizität wird nicht mehr technisch oder dokumentarisch, sondern emotional und performativ erzeugt.
Damit verliert die Fotografie ihren Status als Beweis und wird zum Medium der Überzeugung. Was zählt, ist nicht die Herkunft des Bildes, sondern seine rhetorische Kraft im öffentlichen Diskurs. KI-Bilder verschärfen diese Entwicklung, weil sie ohne reale Referenz funktionieren und dennoch visuell plausibel erscheinen. In ihnen kulminiert der Übergang von der dokumentarischen zur simulativen Bildkultur – einer Kultur, in der visuelle Glaubwürdigkeit zur Frage der Wirkung, nicht der Wahrheit wird.
4. Zwischen äußerer Wahrnehmung und innerer Imagination
Eine aufschlussreiche Perspektive eröffnet der Fotograf und Kurator Boris Eldagsen, der die Fotografie als Schule der Wahrnehmung und die Künstliche Intelligenz als Medium der Selbstreflexion begreift. Während das fotografische Bild, wie er betont, „mit Licht produziert“ wird und damit in der physischen Welt verankert bleibt, operiert die KI im Raum innerer Bilder – sie visualisiert psychische, imaginative Zustände, die zuvor unsichtbar blieben (Frenzel 2025: 23). Der Gegensatz zwischen äußerer Wahrnehmung und innerer Projektion markiert hier keinen Widerspruch, sondern eine wechselseitige Ergänzung: Fotografie richtet den Blick nach außen, KI-Bildproduktion nach innen.
Eldagsen bezieht sich auf die Kreativitätstheorie von Margaret A. Boden, die zwischen kombinatorischer, explorativer und transformativer Kreativität unterscheidet. Künstliche Intelligenz beherrscht die ersten beiden Formen – das Neuarrangieren und Variieren bekannter Muster – mit überlegener Geschwindigkeit und Präzision. Sie kann bestehende visuelle Konventionen durchspielen, neu kombinieren und unzählige Varianten erzeugen. Doch die transformative Kreativität, jener qualitative Sprung ins radikal Neue, bleibt nach Eldagsen dem Menschen vorbehalten. Transformation setzt Bewusstsein, Intention und Erfahrung voraus – Eigenschaften, die über bloße Mustererkennung hinausgehen.
In dieser Differenz erkennt Eldagsen keine Konkurrenz, sondern eine produktive Arbeitsteilung: Während die Fotografie den Blick auf die Welt schärft, sensibilisiert die KI für die Tiefenstrukturen der eigenen Vorstellungskraft. Die Auseinandersetzung mit algorithmisch generierten Bildern wird so zum Experimentierfeld, auf dem sich Wahrnehmung und Imagination neu austarieren. Die Maschine spiegelt die Muster menschlicher Kreativität zurück – und eröffnet dadurch die Möglichkeit, die eigene schöpferische Wahrnehmung zu vertiefen.
5. Eine neue Kultur des Sehens
KI-Bilder bedrohen die Fotografie nicht – sie fordern sie heraus. Sie machen sichtbar, wie fragil das Vertrauen in die Wahrheit des Bildes immer schon war. Vielleicht, so ließe sich mit Varéb sagen, ist die Künstliche Intelligenz das Beste, was der Fotografie passieren konnte: Sie zwingt dazu, das Sehen wieder zu lernen – aufmerksam, zweifelnd, bewusst.
In dieser Perspektive wird die KI zum Katalysator einer neuen visuellen Wachsamkeit. Das eigentliche Ziel bleibt dasselbe wie bei Lori Nix: das Sichtbare neu zu denken – sei es durch Licht, durch Handwerk oder durch Code.
Literatur
Fricke, Christiane (2015): Lori Nix. Bau einer gescheiterten Welt. In: Handelsblatt, 23. 7. 2015, 18:13 Uhr. URL: https://www.handelsblatt.com/arts_und_style/kunstmarkt/lori-nix-bau-einer-gescheiterten-welt/12092952.html (Zugriff: 2. 11. 2025).
Frenzel, Sebastian (2025): „Frisst KI die Künste?“ Interview mit dem Fotografen und Kurator Boris Eldagsen. In: Monopol, November, S. 22–26.
Heinen, Wolfgang (2025): Editorial. In: PHOTO PRESSE, H. 1, S. 3.
Scriba, Jürgen (2024): „Die Angst vor KI ist berechtigt.“ In: PROFIFOTO, H. 5, S. 32–34.
Scriba, Jürgen (2025): „Jegliche Beweiskraft der Fotografie geht verloren.“ In: fotoMAGAZIN, H. 11, S. 11.
Varéb, Dario (2025): „Warum die KI uns das Sehen lehrt.“ In: NZZ am Sonntag, Nr. 29, 20. 7. 2025, S. 43.